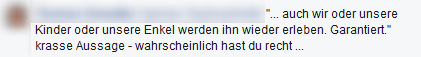tl;dr
Recruiter bzw. Personalberater bekommen in den nächsten Jahren schier übermächtige Konkurrenz von vollautomatischer Software und intelligenten Algorithmen. Wollen sie nicht über kurz oder lang gänzlich von der Bildfläche verdrängt werden, müssen sie sich grundlegend verändern und den Bewerber in den Mittelpunkt ihrer Dienstleistung stellen.
(ein „too long; didn’t read“ ist in diesem Fall besonders notwendig. Ich hoffe aber trotzdem, dass der eine oder die andere die Geduld hat, bis zum Ende dieser gut 2.600 Wörter zu lesen).
Wieso dieser Beitrag überhaupt getippt wurde
Ich denke, ich bin in einer relativ ungewöhnlichen Situation: Ich habe seit nun mehr als acht Jahren intime Einblicke in die Branche der Personalberatung gewinnen können, ohne selbst Personalberater zu sein. Eher genau das Gegenteil, ich bin nämlich Informatiker. Und damit immer wieder auch im Fadenkreuz von Personalberatern. Nicht viele sind in einer vergleichbaren Situation; und die, die es doch sind, schreiben selten darüber. Glaube ich zumindest, denn ich konnte nichts Vergleichbares finden.
Die Branche werde ich nun auf eigenen Wunsch hinter mir lassen. Und nachdem ich eben erst die Bewerbungsprozesse hinter mich gebracht habe, die mit einem solchen Jobwechsel einhergehen, hat mich ein befreundeter Personalberater gefragt: „Wie muss ein Personalberater sein, damit er Tech-Kandidaten anzieht?“.
Er hat das etwas anders formuliert, aber die Essenz sollte stimmen. Ich habe ihm ausführlich per E-Mail geantwortet und wie ich da ohne viel Zusammenhang spontan Sätze und Stichwörter hingetippt habe, habe ich mir vorgenommen, meine Gedanken zum Thema etwas ausformulierter auch an dieser Stelle zu veröffentlichen.
Ich kann von Glück sprechen, dass es für uns Computer-Menschen so einfach ist, einen neuen Job zu finden. Wäre ich in einer anderen Situation, würde etwa frustriert vor Dutzenden knappen Absagen auf meine mit Herzblut geschriebenen Bewerbung sitzen, wären meine Ansichten, und damit auch die folgenden Zeilen, sicher andere. So kann ich aber aus komfortabler Position in aller Ausführlichkeit über Personalberater und ihre Dienstleistung sinnieren.
Was hiermit geschieht.
Personalberater ist ein seltsamer Name
Anfang 2007 bin ich das erste Mal auf den Begriff „Personalberater“ gestoßen – aber auch nur, weil ich eher zufällig bei einem zu arbeiten begonnen hatte. Bis dahin konnte ich mir unter diesem Begriff absolut nichts vorstellen und bis heute finde ich ihn sehr unpassend.
Spontan würde ich unter „Personalberater“ nämlich eher einen Unternehmensberater vermuten. Vielleicht einen, der sich auf Human Resources spezialisiert hat und Unternehmen dabei berät, wie sie die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst gut oder zumindest immerhin möglichst gewinnoptimierend behandeln sollten.
Dabei machen Personalberater etwas ganz anderes: Sie vermitteln Personal, sie besetzen Jobs. Sie sollten sich daher viel passender „Personalvermittler“ nennen. Tun sie aber nicht, vermutlich weil „Personalberater“ eindrucksvoller und wichtiger klingt.
Es gibt übrigens auch keine saubere Übersetzung von „Personalberater“ ins Englische, dict.leo.org beispielsweise spuckt bloß das sehr holprige „recruitment consultant“ aus. Und damit sind wir auch schon bei der – aus meiner Sicht – einzig richtigen, international gültigen Bezeichnung für diese Profession: „Recruiter“.
Personalberater sind Recruiter, denn sie verdienen ihr Geld damit, dass sie Mitarbeiter für Unternehmen rekrutieren. Ich werde deshalb ab sofort nur mehr von Recruitern schreiben.
Ein zwielichtiges Geschäft, oder?
Recruitern wird gerne ein etwas zwielichtiger Ruf zugestanden. Woher der kommt, scheint vor allem aber bloß den Recruitern selbst ein Rätsel zu sein. Ich persönlich habe sowohl sehr gute, als auch recht schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht und meine eigenen Theorien, woher diese schlechte Reputation stammen könnte:
Einerseits trifft man doch manchmal auf Recruiter, die mehr an fragwürdige Investmentbanker oder schleimige Immobilienhaie erinnern und in vermittelbaren Bewerbern nur den schnellstmöglichen Weg zur eigenen Bereicherung suchen.
Andererseits schildern zahllose Medienberichte die Ausbeutung und mittelalterlichen Arbeitsbedingungen bei Personalüberlassern; hier kommen etwa sofort die öffentlichkeitswirksamen Streiks bei Amazon in Deutschland in den Sinn. Dass diese Überlasser nur wenig mit den klassischen Recruitern, über die ich hier schreibe, gemein haben – denn deren Aufgabe endet im Allgemeinen mit der Unterzeichnung des Dienstvertrages – ist in der öffentlichen Wahrnehmung irrelevant. Und oft genug handelt es sich ja dann doch auch wieder um die selben Unternehmen.
Wessen Brot ich ess‘, dessen Lied ich sing
Nun ist Recruiting natürlich ein Geschäft wie jedes andere und es will Geld damit verdient werden. Auftraggeber – und damit Zahlmeister – sind stets die Unternehmen, die Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und deshalb Recruiter mit der Suche nach neuem Personal beauftragen.
Die Ressource der Recruiter sind aber auf der anderen Seite jene Personen, die einen neuen Job suchen. Und je nach Branche kann diese Ressource eine recht knappe – und damit wertvolle – sein. Manche Recruiter erkennen das und bemühen sich, neben ihren Zahlmeistern auch ihre Bewerber als Kunden zu sehen, die es im Zuge der Dienstleistung Recruiting genauso zu betreuen gilt wie ihre Auftraggeber. Andere haben das aber noch immer nicht verstanden und werden sich damit selbst über kurz oder lang den Zugang zu der für sie so notwendigen Ressource verbauen.
Manche Recruiter sind sich also selbst der größte Feind.
Die IT mischt sich immer mehr ein
Oder zumindest der zweitgrößte, denn aus meiner nicht ganz unfundierten Sicht – immerhin arbeite ich seit mehr als acht Jahren an Software für Recruiter – ist die IT der größte Feind der Recruiter.
In den letzten Jahren ist der Markt für Software rund ums Recruiting geradezu explodiert. Hat noch vor einem Jahrzehnt so mancher Recruiter die Lebensläufe seiner Bewerber fein säuberlich in dicken, abgegriffenen Aktenordnern aufbewahrt, geht heutzutage der Weg eindeutig immer mehr Richtung zentraler Datenbanken und Automatisierung.
Big Data und intelligente Algorithmen scheinen mir in diesem Bereich etwas langsamer Einzug zu halten als anderswo, aber die Marschrichtung ist unübersehbar: Recruiter sollen möglichst automatisch von spezialisierter Software die optimalen Bewerber für die zu besetzenden Jobs präsentiert bekommen. Idealerweise soll der Bewerber auch gleich ohne Zutun des Recruiters über den entsprechenden Job informiert oder Zu- und Absagen versandt werden. Einige Jahre noch, und sollte diese Technik tatsächlich endgültig so weit sein.
Eine tolle Entwicklung für Recruiter, denn damit entfällt die für sie so komplizierte manuelle Suche in Datenbanken (oder Aktenordnern) und die zeitaufwändige Kommunikation mit Bewerbern. Offensichtlich ist aber auch, dass Recruiter mit dieser Entwicklung immer überflüssiger wird.
Denn diese ausgefeilte Technologie steht dann auch den beiden Kunden von Recruitern zur Verfügung: Bewerber finden über Internetplattformen per Mausklick die für sie optimalen Jobs, die Bewerbung wird mit einem zweiten direkt abgeschickt. Und Unternehmen finden über die selben Internetplattformen automatisch die für sie optimalen Bewerber und können mit minimalen Zeitaufwand mit ihnen kommunzieren. Das alles allerdings ohne einen teuren Mittelsmann.
Ich glaube, dass in Zukunft wenige große Internetplattformen den Job-Markt beherrschen werden, indem sie genau das den Unternehmern und Bewerbern ermöglichen und bequem anbieten. Der Beginn dieses Trends ist durchaus schon in der freien Wildbahn erkennbar, denn viele Plattformen, die sich bisher damit begnügt haben, bloß simples Anzeigemedium für Online-Stelleninserate zu sein, entwickeln sich in diese Richtung.
Ich bin überzeugt davon, dass diese Veränderung des Recruiting-Marktes unaufhaltsam ist und Recruiter langfristig ganz überflüssig werden. Aber das trifft auf viele Branchen und Berufsgruppen zu und langfristig ist auch, nun ja, schon recht lang und bis zum finalen Endsieg der Algorithmen werden wohl noch Jahrzehnte vergehen.
Recruiter sollten sich trotz dieses Zeithorizontes aber schön langsam Gedanken machen, welchen signifikanten Mehrwert sie ihren beiden Kunden – nämlich den Unternehmen als Auftraggebern und den Bewerbern als wertvolle Ressource – zukünftig bieten können. Einen Mehrwert nämlich, den die intelligenten Algorithmen der Zukunft nicht billiger, schneller und effizienter bieten können.
Social Networks knabbern schon am Kuchen
Die etablierten sozialen Netzwerke, allen voran natürlich Facebook und Twitter, machen es Privatpersonen extrem einfach, Informationen im eigenen Freundeskreis zu streuen. Mussten früher Neuigkeiten wie „Du, bei uns in der Firma hat grad wer gekündigt, darum wir suchen jemand neuen, wäre das nichts für dich?“ noch mühsam von Mund zu Mund verteilt werden, geht das heutzutage bequem und asynchron innerhalb weniger Sekunden.
Ich denke, dass das persönliche Netzwerk eine wichtigere Rolle bei der Jobsuche spielt als gemeinhin angenommen. Das gilt besonders für Personen, die nicht aktiv auf der Jobsuche, aber einer Veränderung durchaus nicht abgeneigt sind; die so genannten „passiven Kandidaten“. Und besonders diese sind nicht auf den diversen Online-Jobplattformen aktiv, aber sehr wohl auf ihren üblichen sozialen Netzwerken.
Recruiter versuchen natürlich – wie jedes andere Unternehmen auch – auf diesen „Social Networks“-Zug aufzuspringen. Zumindest in meiner Wahrnehmung aber mehr bemüht als sinnvoll. Es reicht selten zu mehr als dem vergleichsweise unkreativen Posten von lieblosen, wenig aussagekräftigen Online-Stelleninseraten auf Facebook, Twitter und LinkedIn.
Wie ist ein besserer Recruiter?
Und damit komme nun endlich doch noch zu meiner Antwort auf die eingangs erwähnte Frage meines Recruiter-Kollegen. Ich nehme es mir heraus, sie noch etwas breiter zu formulieren, denn immerhin sollen die vielen hunderte Wörter Einleitung bis zu diesem Absatz nicht ganz umsonst gewesen sein: „Was muss ein Recruiter tun, damit er noch länger Recruiter sein kann?“.
In den letzten Monaten war ich selbst aktiver Teil der Bewerber-Kundengruppe mehrerer Recruiter, meine Antwort auf diese Frage kommt dementsprechend direkt aus dieser Erfahrung und ist so einfach gesagt wie schwierig umzusetzen:
Recruiter müssen endlich beginnen, den Wert ihrer einzigen Ressource – nämlich ihrer Bewerber – richtig einzuschätzen und ihre Dienstleistung entsprechend ausrichten. Sie müssen für ihre Bewerber einen spürbaren, greifbaren Mehrwert bieten und sie so überzeugen, dass komfortable Online-Plattformen nicht der beste Weg zum neuen Traumjob sind.
Und dieser Mehrwert muss auf jeden Fall eindrucksvoller sein, als jedes phantasielose, nichtssagende Stelleninserat, das in einem einzelnen Fachausdruck mit dem Lebenslauf des Bewerber übereinstimmt, so wortgewaltig wie inhaltsleer als „Ihre Top-Chance auf den Job, der perfekt für Sie passt“ anzupreisen. Denn das frustriert Bewerber ungemein und hilft nicht gerade, das Vertrauen in die Kompetenz von Recruitern zu festigen.
Sie müssen endlich beginnen, sich selbst als Dienstleister nicht nur ihrer Auftraggeber – der Unternehmen – zu sehen, sondern gleichermaßen auch als Dienstleister ihrer Bewerber.
Natürlich gibt es Berufsgruppen, wo Bewerber keine wertvolle Rarität darstellen, sondern wo hunderte Bewerbungen für einen einzigen ausgeschriebenen Job herein prasseln. Aber in solchen Fällen werden Unternehmen kaum teure Recruiter mit der Personalsuche beauftragen. Und in Zukunft, wenn intelligente Software die Kommunikation mit Bewerbern weiter vereinfachen und automatisieren, garantiert noch seltener.
In Branchen, wo das Verhältnis von Bewerbern zu Jobs weniger günstig für Unternehmen ist – und ich weiß sehr zu schätzen, dass die Informatik derzeit zu diesen privilegierten Berufsgruppen gehört – erwartet die knappe Ressource auch, entsprechend gehegt und gepflegt zu werden.
Recruiter müssen Bewerbern beweisen, dass sie einen signifikanten Nutzen bieten können. Recruiter müssen Bewerbern zeigen, dass sie verstanden haben, was von einem neuen Job gewünscht und erwartet wird. Sie müssen viel mehr auf Bewerber und deren Bedürfnisse eingehen, als das bisher üblich ist.
Recruiter haben aber schon Vorteile auch, oder?
Meiner Erfahrung nach nennen Recruiter gerne zwei Vorteile, wenn sie mit Bewerbern über ihre Dienstleistung sprechen und versuchen, diesen ihren Nutzen zu vermitteln:
Erstens wäre da: „Ich kann Ihnen mehr Details und Informationen zu einem Job nennen, als aus einem Stelleninserat hervorgeht.“ Was in der Theorie durchaus nachvollziehbar klingt, funktioniert aber in der Praxis leider nur in den seltensten Fällen.
Mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ein Recruiter nach knapp 20 Minuten im Gespräch, in denen ich meinen bisherigen beruflichen Werdegang schilderte, plötzlich eine abgegriffene Mappe voller ausgedruckter Stelleninserate in schmierigen Klarsichtfolien hervor zog. Mit den Worten „Na, dann schauen wir mal, was so auf sie passen könnte“ drehte er mir die Mappe mit der klaren Erwartung hin, dass ich sie jetzt doch bitte durchblättern möge.
Ich hatte mir also nicht nur die Zeit für Anfahrt und Gespräch in seinen Räumlichkeiten – mit fragwürdigem Nutzen für mich – genommen. Nein, ich sollte nun auch noch seine Arbeit erledigen und ihn auf jene Jobs hinweisen, für die er am ehesten Provision für meine Vermittlung kassieren konnte!
Leider fehlt mir in solchen Momenten der Fassungslosigkeit die Spontanität, entsprechend zu reagieren – was ich dann im Nachhinein immer sehr bereue. Überflüssig aber zu sagen, dass es mit diesem Recruiter zu keiner weiteren Zusammenarbeit kam.
Meiner Erfahrung nach ist es aber auch in weniger krassen Fällen eher die Ausnahme, dass Recruiter Genaueres über die von ihnen bearbeiteten Jobs wissen als das, was nicht sowieso schon in den dazugehörigen Stelleninseraten steht. In den allermeisten Fällen fehlt den Recruitern auch ganz einfach auch das fachliche Verständnis, um spezifische Anforderungen an einen bestimmten Job zu bewerten oder richtig einzuordnen.
Der zweite Vorteil, der gerne genannt wird, ist folgender: „Bei mir bekommen sie gleich mehrere passende Jobvorschläge, denn ich kenne den Markt viel besser.“
Ohne Übertreibung kann man wohl behaupten, dass jede halbwegs vernünftige Online-Jobplattform ein Vielfaches mehr an Stelleninseraten zu bieten hat als jeder Recruiter. Der arbeitet schließlich nur mit einem eingeschränkten Kreis an Auftraggebern zusammen. Und der im Übrigen die eigenen Jobs natürlich auch auf eben jenen Plattformen veröffentlicht, wenn er möchte selbstredend auch die größtmögliche Reichweite erzielen.
Leider überwiegt in meiner Erfahrung bei vielen Recruitern die Praxis, Bewerbern nach Möglichkeit schnell und komplikationslos den erstbesten Job schmackhaft zu machen, für den dann eine Provision in Rechnung gestellt werden kann. Bewerber werden viel zu oft nur als unangenehmer Stolperstein zu diesem Ziel gesehen, der viel zu schwierig ist und mehr Arbeit als erhofft verursacht. Mit dieser Einstellung ist es natürlich schwierig, Bewerbern die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie sich erwarten.
Ganz ohne Zweifel, auch in meiner eigenen Erfahrung, gibt es Recruiter, die ihren Beruf als Dienstleistung verstehen, in Bewerbern tatsächlich den Kunden sehen, der sie sind und sich vergleichsweise vorbildlich um sie bemühen. Trotzdem liegt der Fokus vorrangig immer darauf, erst mal den Zahlmeister – nämlich das Unternehmen als Auftraggeber – zufrieden zu stellen. Und manchmal wird sogar, was die Sache unendlich verschlimmert, vor Bewerbern kein Hehl daraus gemacht.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht mag das klarerweise nachvollziehbar erscheinen, im Hinblick auf die beschriebenen Veränderungen des Recruiting-Umfeldes kommt mir dieser Zugang aber äußerst kurzsichtig vor. Besonders in jenen Branchen, wo Bewerber gefragt sind und eine knappe Ressource darstellen, sollte sich der Servicegedanke des Dienstleisters Recruiter viel mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bewerber konzentrieren.
Das sehe nicht nur ich so
Auch andere scheinen dieser Meinung zu sein. So haben dies etwa die Betreiber der äußerst erfolgreichen Frage-und-Antwort-Plattform Stack Overflow rund um Joel Spolsky schon länger erkannt. Ihre Recruiting-Plattform ist Careers so ausgerichtet, dass Bewerber und deren Betreuung im Mittelpunkt steht. Ganz im Gegensatz zu den etablierten Business-Netzwerken wie LinkedIn oder XING.
So haben dort Unternehmen beziehungsweise Recruiter pro Monat nur ein stark eingeschränktes Kontingent an möglichen Kontaktaufnahmen mit Bewerbern. Jeder, der die Flut nichtssagender Spam-Anfragen von Recruitern bei LinkedIn oder XING kennt, weiß so etwas besonders zu schätzen, weil es zwingt den Recruiter, auf ungerichtete Massennachrichten zu verzichten. Er muss stattdessen Bewerber gut vorauswählen und sie möglichst zielgerichtet kontaktieren. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit ungemein, dass Bewerber auch nur wirklich sinnvolle Anfragen und Jobvorschläge bekommen.
Die Fokussierung auf die Bedürfnisse der Bewerber geht auf Stack Overflow Careers sogar so weit, dass Joel Spolsky in einem Podcast halb im Spaß, halb im Ernst erwähnt hat, dass sich während der Konzeptionierung der Plattform sogar die Frage stellte, ob nicht Bewerber – anstelle wie sonst üblich Unternehmen oder Recruiter – für die Benutzung bezahlen sollten. Denn immerhin sollen Bewerber so sehr von der Plattform profitieren, dass ein spürbarer Mehrwert für sie entsteht, der dann auch etwas kosten darf. Die Idee wurde zwar nicht umgesetzt, ich finde es aber sehr spannend, über die Auswirkungen eines solchen Ansatzes nachzudenken.
Fazit
Ich bin überzeugt davon, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre der Großteil aller Jobs von Software und Algorithmen besetzt wird. Recruiter als teure Mittelsmänner werden nur mehr dann beauftragt werden, wenn es um extrem spezialisierte oder besonders diskrete Jobs geht.
Aber gerade in solchen Fällen ist es notwendig, dass der Bewerber als Kunde gesehen wird. Als Kunde, der mindestens genau so gut betreut werden muss wir der eigentliche Auftraggeber. Zumindest in meiner Erfahrung ist die Recruiting-Branche aber noch nicht so weit. Es wäre aber definitiv sehr schön, wenn es ein Recruiter bis hierher, dem Ende dieses langen Beitrags, geschafft hat und mir das Gegenteil beweisen kann.